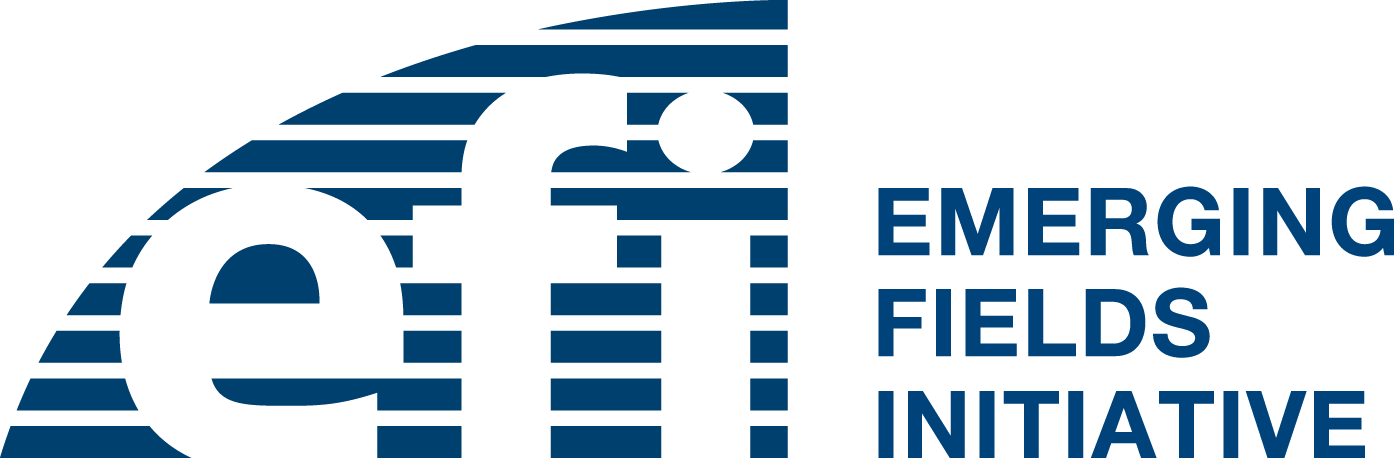Forschung
Verbal Violence against Migrants in Institutions (VIOLIN)
Violence in Institutions (VIOLIN): ein integrativer Zugang zu Erfahrungen und psychischer Gesundheit von Flüchtlingen und Migranten
In diesem Projekt liegt der Schwerpunkt auf verborgenen Formen von Ausgrenzung und verbaler Gewalt gegenüber Migrantinnen und Migranten im institutionellen Kontext. Ziel des Projekts ist, diese Form der Gewalt sichtbar zu machen und aus den gewonnenen Erkenntnissen Empfehlungen für eine kultursensible und egalitäre Kommunikation in den Institutionen zu entwickeln.
Phase 1
Rohleder / Jansen
Als Vorarbeit zur Entwicklung der Verbal Violence Stress Task (VVST) wurde am Lehrstuhl für Gesundheitspsychologie in Zusammenarbeit mit dem Team Linguistik eine Studie mit spanischsprechenden Proband:innen aus Lateinamerika durchgeführt. Die Teilnehmenden durchliefen einen klassischen Stresstest entweder auf Deutsch oder auf Spanisch, wobei verschiedene Biomarker, darunter beispielsweise Speichelproben, sowie verschiedenste Fragebögen (beispielsweise zu Diskriminierungserfahrungen) erhoben wurden. Die Ergebnisse dieser Studie befinden sich derzeit in Auswertung sowie der Vorbereitung zur Publikation. Die VVST wurde in Zusammenarbeit zwischen den Teams Linguistik und Gesundheitspsychologie entwickelt und baut auf dem Trier Social Stress Test (TSST) auf. Eine ausreichende Erprobung der VVST im experimentellen Setting ist in Planung.
Jansen
Semistrukturierte Interviews mit MigrantInnen aus lateinamerikanischen Ländern wurden auf Spanisch durchgeführt, um critical incidents von unpassenden bzw. unangenehmen Situationen mit Vertreter:innen deutscher Institutionen zu sammeln. Sowohl die Perspektive der Betroffenen als auch die Weise, wie sie narrativ diese Erfahrungen berichten, werden in unsere Analyse miteinbezogen. Dieses empirische Material diente als Basis für die Entwicklung des Teil über verbale Gewalt des VIOLIN-Fragebogens.
Jansen / Bendel
Auf der Basis der Kodierung und der Analyse der Sammlung von critical incidents wird ein Erklärungsmodel entwickelt, durch das verschiedene Phänomene wie sprachliche Gewalt, sprachliche Aggression und soziale Diskriminierung differenziert verstanden werden können. Daraus können deren Verbindungen und Überschneidungen besser erkannt werden.
Erim / Bendel
Die Abteilung für psychosomatische und psychotherapeutische Medizin des Universitätsklinikums Erlangen führte folgende qualitative Untersuchungen durch: Fokusgruppen mit Expert*innen aus der Migrationsarbeit und mit Betroffenen (Mitarbeiter*innen öffentlicher Institutionen), türkischsprachigen Psychotherapeut*innen, Lehrer*innen von Berufsintegrationsklassen und Schüler*innen der Berufsintegrationsklassen.
Die Fokusgruppen zeigen folgende Probleme auf, die in den VIOLIN Online-Survey (Phase 2) einfließen: Ressourcenproblem (z.B. Dolmetschermangel, Informationsmangel), juristisches Problem (z.B. diskriminierende Gesetze; Rechte abhängig vom Aufenthaltsstatus), Kulturproblem (z.B. schwierige Verständigung, unterschiedliche verinnerlichte Regeln, Normen und Ansichten).
Jansen / Bendel
Die gesammelten Erfahrungen werden derzeit analysiert, um Institutionen, Bereiche und Kontexte, in denen sprachliche Gewalt gegen Migrant:innen vorkommt, sowie verbundene Interaktionsmuster, zu identifizieren. Dies dient als Ausgangspunkt für weitere quantitative Erhebungen und Messungen, zum Beispiel den VIOLIN-Fragebogen (demnächst).
Erim
Im Jahr 2019 wurde der zweite Erhebungszeitpunkt der prospektiven register-basierten Studie syrisch stämmiger Geflüchteter mit Aufenthaltsgenehmigung (PROSREF) durchgeführt. Dabei wurden neben der psychischen Gesundheit auch die Auswirkungen von verbaler Gewalt und wahrgenommener Diskriminierung als moderierende postmigratorische Belastungsfaktoren erfasst. Eine Replikationsstudie für syrische Geflüchtete wurde in Lethbridge, Kanada aufgelegt und wird einen internationalen Vergleich ermöglichen.
Sowohl zum ersten Messzeitpunkt der PROSREF Studie im Jahr 2017, als auch zum zweiten Messzeitpunkt 2019 erfüllten 14-30% der teilnehmenden syrischen Geflüchteten die Kriterien einer klinisch relevanten Depression, Angststörung oder einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die publizierten Ergebnisse der longitudinalen Messungen (Borho et al., 2020) weisen darauf hin, dass die psychische Belastung für diese Flüchtlingspopulation trotz verbesserter Lebensbedingungen auf einem konstant hohen Niveau bleibt. Höhere wahrgenommene Diskriminierung, eine höhere Anzahl traumatischer Erlebnisse sowie eine kürzere Restgültigkeit der Aufenthaltserlaubnis zeigten sich als messzeitpunktunabhängig wichtigste Prädiktoren psychischer Belastungen. Zusammengefasst stellte sich bezüglich der selbst berichteten wahrgenommenen Diskriminierung heraus, dass diese zwar nur selten von den syrischen Geflüchteten berichtet wurde, aber als signifikanter Prädiktor psychischer Erkrankungen galt.
Phase 2
Bendel / Erim / Jansen / Rohleder
Durch die Zusammenführung aller bisherigen Forschungsergebnisse aus Phase 1 wurde ein Fragebogen zu wahrgenommener verbaler Gewalt in Institutionen entwickelt, der in einem nächsten Schritt im Rahmen eines quantitativen VIOLIN-Online-Surveys mit verschiedenen Gruppen von Migranten:innen und Geflüchteten eingesetzt werden soll. Ziel ist es, anhand einer großen Stichprobe belastbare Daten über das Ausmaß und die Auswirkungen (z.B. auf die psychische Gesundheit) verbaler Gewalt in Institutionen auf Migrant:innen und Geflüchtete zu erheben. Der Online-Fragebogen liegt in neun verschiedenen Sprachen vor: Deutsch, Arabisch, Englisch, Farsi/Dari, Französisch, Türkisch, Pashto, Polnisch und Spanisch.
Link zum anonymen Online-Fragebogen: https://ww2.unipark.de/uc/violin/.